
Sommer, 1969 in Belfast: Der neunjährige Buddy (Jude Hill) ist Sohn einer typischen Arbeiterfamilie in der nordirischen Hauptstadt. Er liebt Kinobesuche, Matchbox-Autos und seine Großeltern Granny (Judi Dench) und Pop (Ciarán Hinds) – außerdem schwärmt er für eine seiner Mitschülerinnen. Als jedoch die gesellschaftspolitischen Spannungen in Belfast eskalieren und es daraufhin sogar in der friedlichen Nachbarschaft zu grausamen Gewalteruptionen kommt, endet die idyllische Kindheit von Buddy mit einem Schlag. Während seine Eltern Ma (Caitriona Balfe) und Pa (Jamie Dornan) versuchen, die Zukunft der Familie zu sichern, ist Buddy gezwungen, viel zu schnell erwachsen zu werden. Trotz allem versucht er, seine Lebensfreude und seine Begeisterung für Film und Fernsehen nicht zu verlieren ...


Ein ganz persönlicher Oscar-Favorit
Von Madeleine Eger 2:17
2:17
 1:55
1:55
 2:29
2:29
 2:04
2:04









Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren

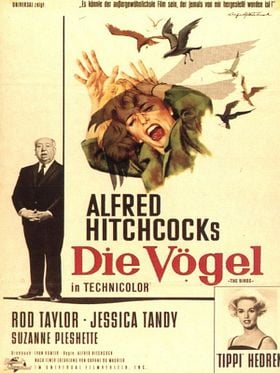


Finde mehr Filme : Die besten Filme des Jahres 2021, Die besten Filme Drama, Beste Filme im Bereich Drama auf 2021.











